AI zerstört nicht die Kunst. Ideenlosigkeit schon.
Vor kurzem hörte ich eine Podcast-Folge mit dem Fotografen und Musikvideo-Regisseur Rankin. Wem sein Name nicht sofort geläufig ist, dem werden auf jeden Fall die von ihm porträtierten Menschen bekannt vorkommen: Björk, Kate Moss, Madonna, David Bowie und Queen Elizabeth II. — die ganze Liste wäre länger als dieser Artikel. Sicher ist: Er gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten britischen Fotografen unserer Zeit.
Umso erstaunlicher war es für mich, in dieser Folge ein ausgesprochen ambivalentes Verhältnis zur AI zu hören. Er lehnt sie eben nicht pauschal ab, sondern beschreibt einen Zustand zwischen Faszination und Abwehr: „I’m absolutely in love with this thing, and I actually hate it at the same time.“

„Urban Ballet“, wie es laut Midjourney in meinem Stil aussehen würde. Auch wenn die Sinnhaftigkeit dieser Nutzung angezweifelt werden kann, können andere Dinge sehr wohl Sinn ergeben.
Er begann, sich mit AI zu beschäftigen, nicht aus Zwang, sondern aus einer grundsätzlichen kreativen Neugier heraus — und aus dem Bedürfnis, den vermeintlichen „Gegner“ zu verstehen. Er sagt völlig zu Recht: „I don’t want to be that person that judges it without actually having tried it.“ Dieses „Nicht-Urteilen-ohne-Testen“ ist eine intellektuelle Haltung, die vielen Debatten heute guttut und in der Kreativbranche leider immer seltener geworden ist.
Rankin betonte sowohl im Podcast als auch im Interview mit Nativve, dass es in seiner Natur liege, neue Werkzeuge zunächst auszuprobieren, anstatt sie reflexartig abzulehnen. Genau diese Haltung hat ihn dorthin gebracht, wo er heute steht.
Aus erster Neugier wurde bei ihm längst ein ernsthaftes Arbeitsfeld. Er hat ein komplettes Magazin- und Ausstellungsprojekt mit AI umgesetzt („FAIK“) und generiert privat mit Begeisterung Musik über Suno.

Establisher um die Stimmung und den Ort in einer SHEROES-Serie festzulegen, generiert mit Googles Nano Banana Pro.
Gerade deshalb war es so überraschend zu erleben, wie selbstverständlich ein Urheber, der wie kaum ein anderer über Jahrzehnte eine eigene Bildsprache etabliert hat, mit dieser neuen Technologie spielt. Doch was ihn auszeichnet, ist, dass er im Gegensatz zu vielen Kolleg:innen verstanden hat, dass Abwarten keine Strategie ist: „Morally you feel bankrupt, but if you don’t use it, you probably go bankrupt.“ Man könnte sagen: Moral ist ein Luxus, den man sich erst einmal leisten können muss — ein Gedanke, der gerade in sozialen Netzwerken vielen Diskussionen fehlt. Zudem verwechseln viele moralische Überlegenheit mit moralischem Überlegenheitsgefühl.
Ich bringe an dieser Stelle gerne das Beispiel Ryanair, das es fast jeder intuitiv versteht. Es wird immer wieder über Kund:innen geschimpft, die das „Ausbeutungssystem“ von Michael O’Leary ermöglichen. Doch das System existiert nicht allein, weil Kund:innen böse sind, sondern weil es Personal gibt, das — mangels Alternativen — bereit ist, zu diesen miserablen Bedingungen zu arbeiten. Nicht aus Überzeugung, sondern aus existenziellen Gründen. Und genau so funktioniert der Markt für Berufsfotograf:innen seit über hundert Jahren: Die Preisspirale dreht sich unaufhörlich, weil Menschen bereit sind, für weniger zu arbeiten als ihre Vorgänger:innen. Schon 1908 gab es Beschwerden darüber — siehe diesen Artikel.

Ein großes Problem sind die Trainingsdaten. Midjourney war gar nicht in der Lage, brauchbare Broken Body Bilder zu generieren, da es Gipsverbände (noch?) nicht beherrscht.
Wenn also immer mehr Mitbewerber:innen dank AI produktiver, effizienter und vielseitiger werden, wäre es töricht, sich dieser Entwicklung komplett zu verschließen. Nicht aus Begeisterung, sondern schlicht, weil Marktmechanismen sonst unbarmherzig über einen hinwegrollen.
Viele Argumente gegen AI im künstlerischen Kontext wirken für mich zudem erstaunlich schwach. Ich kann das ständige Klagen über das Urheberrecht kaum noch hören — vor allem, weil alle relevanten Verbände geschlafen haben, als § 44b UrhG eingeführt wurde. Und Hand aufs Herz: Fotograf:innen haben sich schon immer ausgiebig bei Kolleg:innen bedient. Moodboards bestehen aus kopierten Bildern. Stile werden seit Jahrzehnten imititiert. Der einzige Unterschied: Heute können es auch Menschen ohne technische Begabung tun. Das mag bitter sein, aber es macht die frühere Imitation nicht moralisch besser.

Googles Nano Banana Pro ist da schon deutlich weiter.
Natürlich schafft die neue Leichtigkeit des Generierens echte Probleme: Fakes, Bias, die Frage nach Kreativität, Urheberrecht und Einkommensverlusten. Diese Themen müssen diskutiert und reguliert werden. Aber die Branche klammert sich verzweifelt an den Trainingsdaten fest, als wäre dort der einzige Hebel. Ja, AI kann Bilder erzeugen, die an Originale herankommen — aber das konnte man vorher mit genügend Know-how ebenfalls. Und Rankin selbst hat Bilder „im Stile von Rankin“ prompten lassen. Die Wahrheit ist: Kopiert wurde schon immer. Nur das Werkzeug hat sich verändert.
Seit es Kunst gibt, wird behauptet, neue Technologien würden sie zerstören. Die Fotografie wurde im 19. Jahrhundert als „Nicht-Kunst“ abgetan, weil man angeblich keine handwerkliche Meisterschaft brauche. Und jetzt soll AI die Kunst bedrohen, weil man nicht mehr fotografieren oder musizieren können muss? Doch immer bleibt eine Konstante: Die Idee ist entscheidend, nicht das Werkzeug. Rankin und beispielsweise Boris Eldagsen verfügen über fotografische Fähigkeiten, aber vor allem über konzeptionelle Stärke. Das unterscheidet ihre AI-Arbeiten von der Flut generischer Bilder, die Midjourney im Sekundentakt ausspuckt.

Ein reales Bild aus der Broken Body Serie. Nella und Jule, Schülp 2014.
Ich freue mich daher eher über ein gut durchdachtes, konzeptionell starkes AI-Bild als über ein weiteres austauschbares Street-Foto, das weder Idee noch Haltung besitzt.
Für Musik gilt dasselbe. Warum sollte ein AI-generiertes Stück eines Menschen, der etwas ausdrücken möchte, aber nicht über musikalische Fähigkeiten verfügt, minderwertiger sein als seit Jahrzehnten diese Pop-Songs aus der Retorte, die von 60-jährigen Männern geschrieben werden, um von austauschbaren Boy- oder Girlgroups performt zu werden?
Künstlerische Authentizität entsteht nicht durch die Technik, sondern durch Intention und Kontext. Sonst müssten wir ernsthaft die Arbeiten von Andreas Gursky oder Gregory Crewdson infrage stellen. Machen seine fotografischen Fähigkeiten Gurskys Millionenwerke aus — oder eher die Leistung seiner Retuscheure, die komplexe Composings mit steinzeitlich anmutenden Geräten erarbeiten haben? Crewdson ist in dieser Logik besonders interessant: Er setzt selbst fotografisch nichts um, sondern kommuniziert seine Vision an ein großes Team, das sie realisiert. Er ist überspitzt formuliert ein Mensch, der anderen seine Vision „promptet“ und die diesen Vorgaben folgen müssen. Sein kreativer Beitrag ist konzeptionell, nicht technisch. Warum sollte das bei Maschinen plötzlich illegitim sein?

AI kann gerade für narrative Serien Bilder erstellen, die fotografisch Budgets oder Möglichkeiten sprengen würden. Wie hier in einer der SHEROES-Serien.
Natürlich ist technische Meisterschaft beeindruckend — so wie echte Stunts beeindruckender sind als CGI. Aber am Ende zählt das Ergebnis. Wenn die Technik in den Vordergrund rückt, liegt das meistens daran, dass die Technik zu schlecht oder das Ergebnis nicht überzeugend war.
Den wirtschaftlichen Impact dagegen zu bewerten, ist schwierig. Viele Kreativberufe erleben einen Rückgang, wie diese Statistik zeigt, aber die Ursachen sind vielfältig: Marktsättigung, Sparzwang der Auftraggeber, Inhouse-Lösungen, veränderte Workflows. Die Pressefotografie hat es vorgemacht: Redakteure machen die Bilder gleich selbst. Und wir Fotograf:innen handeln genauso. Wer hat für Flyer Texter:innen, Designer:innen oder Logoprofis engagiert? Die meisten hätten sich das nie leisten können und sich entsprechend selbst drangesetzt.
Und dadurch entgeht auch niemandem etwas: Viele Menschen, die Musik über Suno generieren, hätten nie Musiker bezahlen können. Musiker:innen verlieren dadurch also kein Einkommen, denn dieser Auftrag hätte nie existiert. Dasselbe gilt für viele andere AI-generierte Grafiken, Illustrationen oder Übersetzungen. Auch die „Gedanken zur Fotografie“ könnten nicht zweisprachig erscheinen, müsste ich ein Übersetzungsbüro bezahlen. Die AI ist hier kein Feind, sondern eine bisher unerschwingliche Ressource.
Wir erleben seit Jahren eine Demokratisierung der Kunstproduktion. Jeder kann heute Podcasts, Videobeiträge, Magazine oder Bildbände veröffentlichen. Der Werkzeugkasten wächst ständig. Ob wir als Künstler:innen relevant bleiben, hängt deshalb weniger von der Technologie ab — sondern von unserer Fähigkeit, Ideen zu entwickeln, Erlebnisse zu schaffen und Authentizität in unseren Prozessen wieder sichtbar zu machen (siehe dazu auch dieser Artikel). 08/15-Bildwelten sind am stärksten bedroht. Menschen mit etwas zu sagen dagegen haben nun eine weitere Klaviatur, um Ausdruck zu finden.
Für viele dieser Argumente und Gedanken kann man sicher ein Für und Wider finden und ich freue mich auf eine lebhafte, aber respektvolle Diskussion. Reines AI-Bashing oder kopfloses Hineinstürzen hilft niemanden weiter.
Dieser Text ist auch in der fünften Ausgabe meines Zines „Gedanken zur Fotografie“ erschienen. Du kannst Dir das Zine hier entweder kostenfrei als PDF herunterladen oder es Dir für günstige 4.90 € als gedruckte Version bestellen.
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!


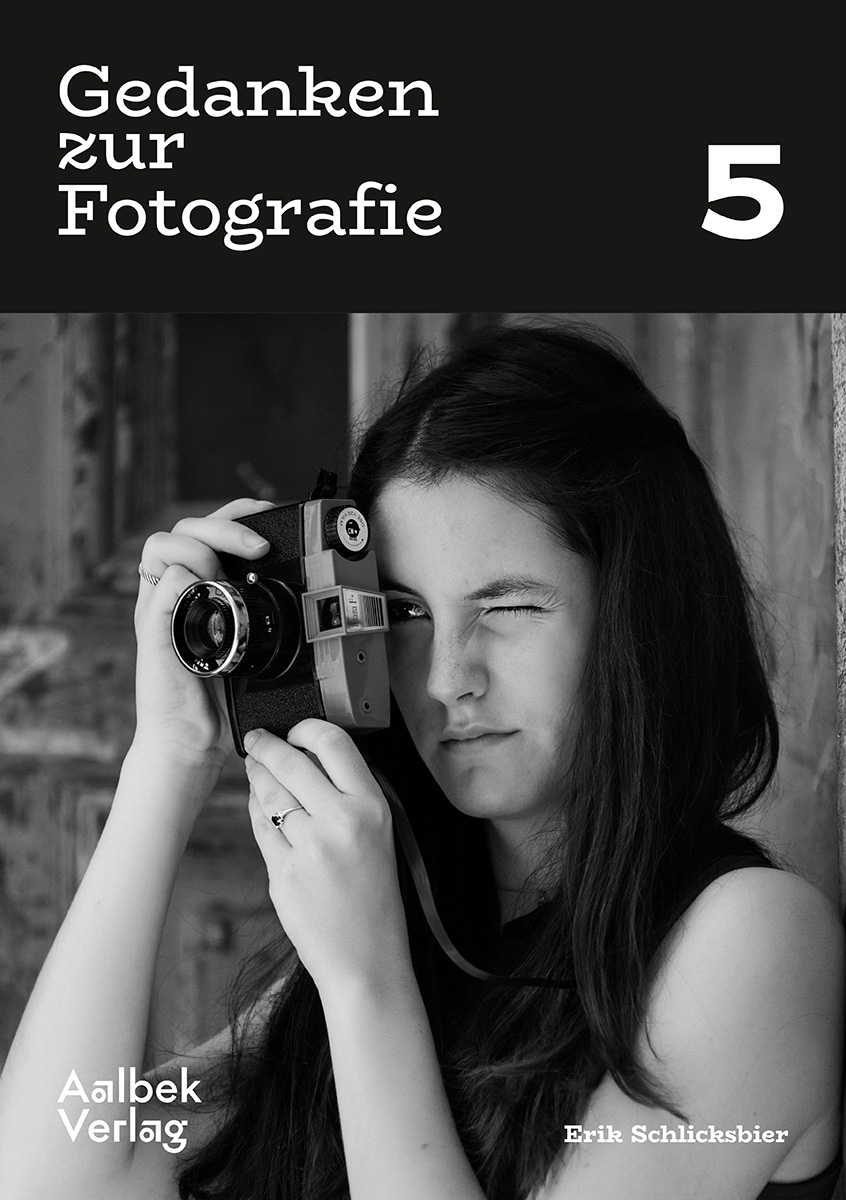

Ich sehe das sehr ähnlich. Genauso könnte man behaupten, Synthesizer hätten „die Musik“ kaputt gemacht. Es gibt Leute, die damit tolle oder schreckliche Musik gemacht haben. Als Synthesizer ein neues Werkzeug in der Branche wurden. Heute erleben wir eine ähnliche Zeit mit KI.